II: Ernst Gernot Klussmann – String Quartet No. 1 op. 7 (1928–30)
Bitte wählen Sie einen Titel, um hineinzuhören

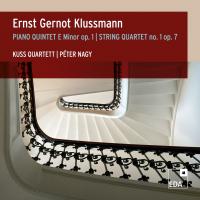 I: Ernst Gernot Klussmann – Piano Quintet E minor op. 1 (1925)
I: Ernst Gernot Klussmann – Piano Quintet E minor op. 1 (1925)I: Ernst Gernot Klussmann – Piano Quintet E minor op. 1 (1925)
01 Allegro impetuoso
I: Ernst Gernot Klussmann – Piano Quintet E minor op. 1 (1925)
02 Adagio molto e cantabile
I: Ernst Gernot Klussmann – Piano Quintet E minor op. 1 (1925)
03 Scherzo
I: Ernst Gernot Klussmann – Piano Quintet E minor op. 1 (1925)
04 Finale
II: Ernst Gernot Klussmann – String Quartet No. 1 op. 7 (1928–30)
05 Adagio
II: Ernst Gernot Klussmann – String Quartet No. 1 op. 7 (1928–30)
06 Allegro
II: Ernst Gernot Klussmann – String Quartet No. 1 op. 7 (1928–30)
07 Marsch
II: Ernst Gernot Klussmann – String Quartet No. 1 op. 7 (1928–30)
08 Scherzo
II: Ernst Gernot Klussmann – String Quartet No. 1 op. 7 (1928–30)
09 Finale
....................................................................................................
Grußwort
Die Hochschule für Musik und Theater Hamburg (HfMT) feiert im Jahr 2025 ihr 75-jähriges Bestehen. Sie blickt auf eine Geschichte zurück, in der Komponisten und Musiktheoretiker von Anfang an und bis heute eine bedeutende Rolle gespielt haben, sowohl in lehrender wie in leitender Funktion. Ernst Gernot Klussmann wurde 1942 von Köln nach Hamburg berufen, um die Direktion des Vogt'schen Konservatoriums zu übernehmen und ihre Transformation in die führende staatliche Musikhochschule Norddeutschlands zu organisieren. Dieser Prozess konnte aufgrund der Kriegsereignisse und der starken Zerstörung Hamburgs erst 1950 abgeschlossen werden. Zwischen 1950 und seiner Emeritierung 1966 leitete Klussmann die Geschicke der Hochschule als deren Vizepräsident mit und trug als hervorragender Kompositions- und Theorielehrer zu ihrem Ruf bei. Mehrere Professoren der HfMT der nachfolgenden Generation sind bei ihm in die Lehre gegangen. Berichte von seinen legendären Repertoirekenntnissen und seinem großen und großzügigen Engagement für die Studierenden kursieren noch heute.
Klussmann demonstrierte, wie sich kompositorische Praxis, Analyse und Wissensvermittlung gegenseitig befruchten können. Er repräsentierte den Typus des musikalischen Universalgelehrten, der uns noch heute Vorbild ist in einer Zeit, in der sich schöpferisches Tun und die Reflektion darüber in einer digitalen und immer weiter ausdifferenzierten Welt ganz neuen Herausforderungen stellen muss.
Klussmanns Sohn übertrug in einer Verfügung von 1980 dem jeweiligen Präsidenten der HfMT die Verantwortung für den künstlerischen Nachlass seines Vaters. Ich freue mich deshalb sehr – und über mein Amt hinaus – über das Zustandekommen dieser ersten Klussmanns Werken gewidmeten CD-Produktion. Ich bedanke mich bei allen an ihrem Zustandekommen Beteiligten und hoffe, dass sie Auslöser ist für die weitergehenden Beschäftigung mit einem originellen Komponisten, bei dem es so vieles zu entdecken und wiederzuentdecken gibt.
Prof. Dr. Jan Philipp Sprick, Präsident der Hochschule für Musik und Theater Hamburg
März 2025
Zum Geleit
Ernst Gernot Klussmann war mir seit meinen Studienzeiten an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater (HfMT) in den 1980er Jahren ein Begriff, aber ich hatte keine Vorstellung von seinem Schaffen als Komponist. Er war der Lehrer dreier meiner Professoren, so dass ich mich – ohne recht zu wissen, was das implizierte – als sein Enkelschüler sah. Deswegen wurde ich sehr hellhörig, als mich Philipp Nedel anlässlich unseres Projektes der Gesamtaufnahme der Klaviersonaten von Hans Winterberg auf Klussmann ansprach und die bevorstehende Produktion des Kuss Quartetts mit zwei frühen Kammermusikwerken des Komponisten, dem spätestromantischen Klavierquintett und dem expressionistischen 1. Streichquartett. Die Funk Stiftung unterstützte nicht nur diese erste Aufnahme überhaupt von Kompositionen dieser hochinteressanten und für das Hamburger Musikleben so wichtigen Persönlichkeit, sondern auch Erstausgaben der aufgenommenen Werke bei dem noch jungen Frankfurter Laurentius-Verlag. Ich freue mich, dass wir diese Produktion anlässlich der Jubiläumsfeiern zum 75. Bestehen der HfMT – zu deren Gründungsvätern Klussmann gehörte – präsentieren können. Mein herzlicher Dank gilt der Hamburger Funk Stiftung, die dieses Projekt ermöglichte und nachhaltig unterstützt, dem Präsidenten der HfMT Prof. Dr. Jan Philipp Sprick, der ihm einen Platz im Rahmen des Hochschul-Jubiläums einräumt, Dr. Carsten Bock, dem Herausgeber der Erstausgaben der hier präsentierten Werke und Autor des folgenden Einführungstextes, und last but not least dem Kuss Quartett und Péter Nagy – fantastischen Interpreten einer hochkomplexen und gleichzeitig hochemotionalen Musik jenseits der Trends der 1920er Jahre.
Klussmann hatte als Komponist viel zu sagen, und wir hoffen, dass diese Produktion einen Anstoß gibt zur Entdeckung vor allem seines nach dem Zweiten Weltkrieg in Hamburg entstandenen Œuvres, darunter wichtige, bis heute nicht uraufgeführte Werke.
Frank Harders-Wuthenow, eda records
März 2025
Ernst Gernot Klussmann – Konturen eines Lebens
Ernst Gernot Klussmann gehörte zu den herausragenden Persönlichkeiten des Hamburger Musiklebens von den frühen 1940er Jahren bis zu seinem Tod 1975. Dennoch sind Spuren seines künstlerischen Schaffens nur mit großer Mühe zu finden. Die vorliegende Einspielung zweier Frühwerke ist die erste Klussmann gewidmete CD-Produktion überhaupt. Wichtige Kompositionen aus seiner Feder sind noch immer nicht verlegt und bis heute nicht uraufgeführt. Eine Erklärung dafür liegt kaum in ihrer künstlerischen Qualität. Möglicherweise aber in dem Stigma, das Künstlern anhaftet, die während der Nazizeit in Deutschland arbeiteten, die nicht verfolgt, ins Exil getrieben oder umgebracht wurden. Klussmann war im Frühjahr 1933 in die Partei eingetreten, was ausreichte, ihm einen Platz in Fred K. Priebergs Handbuch deutscher Musiker zu sichern, dem "Schwarzbuch" der deutschen Musikgeschichte, und für einen Makel, der ihm trotz seiner großen Verdienste nach dem Krieg anhaftete. Mit Klussmann gibt es nicht nur einen hochinteressanten Komponisten (neu) zu entdecken, der alles andere war als ein Nazi. Sein "Fall" führt nachdrücklich vor Augen, wie wichtig es ist, zu verstehen, was genau im deutschen Kulturleben nach der Machtübernahme passiert ist, was möglich war und was nicht, und sich die Frage zu stellen, wie heroisch man selbst in einer vergleichbaren Situation gehandelt hätte.
Aufgewachsen ist Klussmann in Hamburg-Bergedorf, einer zunächst selbständigen Stadt, die 1938 in die Stadt Hamburg eingemeindet wurde. Über seine musikalische Ausbildung während seiner Jugendzeit ist fast nichts bekannt. Dass Klussmann bereits während seiner Schulzeit ein guter Instrumentalist war, belegt allerdings eine Rezension aus dem Jahr 1919, in der er als Pianist und Organist im Rahmen einer Gedenkfeier für die Toten des Krieges 1914–1918 an seiner Schule erwähnt wird.
Einen großen Einfluss auf die musikalische Entwicklung Klussmanns wird sicherlich sein Patenonkel Hermann Behn (1857–1927) gehabt haben. Behn, Komponist und Pianist, veröffentlichte eine Vielzahl von Klavierauszügen des etablierten symphonischen Repertoires. Er war ein Freund und Förderer Gustav Mahlers, von dessen 2. Symphonie er einen Klavierauszug für zwei Klaviere anfertigte. Nach dem Abitur 1919 konzentrierte sich Klussmann umgehend auf seine weitere musikalische Ausbildung. In einem von ihm verfassten Lebenslauf heißt es nur knapp: "… und studierte von 1919–1924 privat Komposition und Orgel bei Professor Felix Woyrsch (Altona), Klavier bei Arnold Winternitz und Ilse Fromm-Michaels." Woyrsch (1860–1944), der 1903 zum Städtischen Musikdirektor ernannt wurde, setzte sich als Komponist mit allen gängigen Gattungen der klassisch-romantischen Musik auseinander, die sicherlich auch Klussmanns Kompositionsunterricht prägten. Anhand der überlieferten Kompositionen lässt sich bei Klussmann eine deutliche Neigung zum Symphonischen erkennen. Im Nachlass finden sich überwiegend Partitur-Entwürfe zu Symphonien: Symphonie f-Moll (1., 3. und 4. Satz) 1918/19, Symphonie d-Moll (1. Satz) 1919 und Passacaglia c-Moll (altes Finale zur c-Moll Symphonie Nr. 1) 1920/21. Bei der Pianistin und Komponistin Fromm-Michaels (1888–1986) könnte Klussmann auch die aktuelle Entwicklung der Musik kennengelernt haben. Der Neuen Musik verpflichtet, spielte sie auf ihren Solo-Klavierabenden die Werke zeitgenössischen Komponisten wie Hindemith, Busoni, Strawinsky und der 2. Wiener-Schule. Seine Ausbildung setzte Klussmann an der Münchener Akademie der Tonkunst fort, wo er die Meisterklassen für Komposition bei Prof. Joseph Haas und Dirigieren bei Prof. Dr. Sigmund von Hausegger besuchte, die er bereits 1925 mit einem außerordentlichen Zeugnis abschloss. Im Sommer des gleichen Jahres war er als Solorepetitor bei den Bayreuther Festspielen tätig. Seine erste ordentliche Stelle konnte Klussmann am 1. Oktober 1925 als Lehrer für theoretische Fächer an der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln antreten. Für die Bewerbung auf diese Stelle konnte er, neben Beurteilungen von Haas und v. Hausegger, eine musikpädagogische Zusatzqualifikation vorweisen, die er in Kassel erworben hatte. 1934 wechselte er mit derselben Fächerkombination zur Kölner Hochschule für Musik, wo er 1936 zum Professor für Partiturspiel und Instrumentation ernannt wurde.
Die Machtergreifung durch die Nationalsozialisten 1933 verlief in Köln sehr stringent. Nach wenigen Wochen waren alle gesellschaftlichen Bereiche von der "Gleichschaltung" erfasst. An der Musikhochschule bzw. der Rheinischen Musikschule wurden bereits im März 1933 alle jüdischen Lehrer und Schüler entfernt. Walter Braunfels, der zusammen mit Hermann Abendroth Direktor der Hochschule war, wurde als sogenannter "Halbjude" am 2. Mai 1933 seiner Ämter enthoben. Die Absetzung Abendroths, der als künstlerischer Leiter des Gürzenich- Orchesters moderne Komponisten förderte und deshalb schon einige Zeit unter Beobachtung stand, gestaltete sich dagegen schwieriger. Dabei hatte sich im Laufe der 1920er Jahre eine sehr aggressive Stimmung an der Hochschule entwickelt, die auch mit Hilfe von Übergriffen der SA aufrechterhalten wurde. Man kann davon ausgehen, dass insbesondere die Dozenten der Hochschule daran beteiligt waren, die schon länger Mitglieder der NSDAP waren, wie z. B. Richard Trunk (Eintritt 01.11.1931) und Hermann Unger (Eintritt 01.01.1932). Zu diesem Kreis gehörte auch Walter Trienes (Eintritt 1930), der zunächst als Schriftleiter des Westdeutschen Beobachter publizistisch gegen die Kölner Musikhochschule in Erscheinung trat und ab 1933 als Beauftragter der NSDAP an der Musikhochschule eingesetzt wurde. Zu der Uraufführung von Klussmanns Orgelkonzert auf dem Internationalen Musikfest in Stuttgart urteilte Trienes bereits 1928 unter dem Stichwort "Entwurzelte Kunst": "In dem Orgelkonzert von Klussmann hat die Zersetzung der tonalen Grundlagen einen Endweg erreicht. Die Aufnahme zeigte, daß die Hörer nicht gewillt sind, ihm zu folgen." Aus Angst vor einer möglichen Entlassung, sei er, so Klussmann nach Kriegsende, am 01.04.1933 in die NSDAP eingetreten, um seine junge Familie zu schützen. Insbesondere durch seine beiden ersten Symphonien konnte Klussmann in den 1930er Jahren Anerkennung sowohl beim Publikum als auch bei der Fachpresse erlangen. Neben vielen Konzertrezensionen spiegelt sich dieses Interesse an seiner Musik in einem mehrseitigen Artikel in der Zeitschrift für Musik (Heft 5, 1936) wider. Überblickt man seine Kompositionen dieser Zeit, fällt auf, dass es sich dabei überwiegend um Instrumentalmusik handelt, wobei die klassischen Gattungen im Vordergrund stehen.
Mit dem Kriegsausbruch 1939 wurden die Arbeitsbedingungen an der Musikhochschule in Köln immer schwieriger und Klussmann lebte in ständiger Angst, zum Militärdienst eingezogen zu werden. Zeugnis davon legen die Briefe Klussmanns an Katharina Holger geb. Schmitz (1902–1982) ab. Holger war als Schauspielerin an einer Neuinszenierung von Goethes Iphigenie 1935 in Bielefeld beteiligt, zu der Klussmann den Auftrag bekommen hatte, eine neue Schauspielmusik zu komponieren. Dieser Briefwechsel, vom dem lediglich die Briefe Klussmanns überliefert sind, stellt eine wichtige Quelle dar, um sich der Person Klussmann zu nähern.
Bereits 1937 bewarb sich Klussmann um eine Stellung in Hamburg. Das dort ansässige Vogtsche Konservatorium sollte in eine Musikschule umgewandelt werden, die dann selbst als Vorstufe für die Gründung einer Musikhochschule genutzt werden sollte. In den Briefen an Holger bringt Klussmann die Hoffnung zum Ausdruck, die Kölner Hochschule verlassen zu können, wobei er stets die Befürchtung hatte, dass ihn die Musikhochschule nicht ziehen lassen könnte. Das Verfahren wurde zudem durch seine Einberufung zum Militärdienst 1941 erschwert. An 1. Mai 1942 wurde Klussmann schließlich zum Direktor der Schule für Musik und Theater der Hansestadt Hamburg ernannt. Bis 1944 widmete sich Klussmann mit großem Eifer seiner neuen Tätigkeit, wo neben administrativen Entscheidungen, wie z. B. der Auswahl von Lehrpersonal, insbesondere die Aufstellung von Satzung, Lehrplänen und Schulordnung zu seinem Aufgabenbereich gehörte. Auf Grund des Kriegsverlaufs wurde die Schule geschlossen.
"Nun sind ja sämtliche Katzen aus dem Sack. Auch meine Schule wird zum 1.9. geschlossen, ich bin bereits zur Einberufung freigegeben." (Brief an Holger, 17.08.1944). Die letzten Kriegsmonate verbrachte Klussmann als Bodenpersonal auf dem Luftwaffenstützpunkt Leck in Schleswig-Holstein. Mit den Folgen seiner Mitgliedschaft in der NSDAP musste Klussmann sich bereits kurz nach Kriegsende auseinandersetzten. Im Rahmen der Entnazifizierung Deutschlands durch die jeweiligen Militärregierungen der Besatzungszonen, wurde er am 17. September 1945 als Direktor der Musikschule entlassen: "Im Auftrage des Bürgermeisters wird Ihnen eröffnet, dass Sie auf Grund des Gesetzes Nr. 6 der Militärregierung vom 11. Mai 1945 und auf Anordnung der Militärregierung vom 7. September 1945 aus dem Dienstverhältnis zu entlassen sind." Gegen die Anordnung legte Klussmann unverzüglich Widerspruch ein, wobei er in Bezug auf seine Parteimitgliedschaft von einer strategischen Entscheidung sprach, um den Drangsalierungen seiner Kollegen an der Kölner Musikschule zu entkommen. Diese spezifische Situation in Köln wurde im Widerspruchsverfahren versucht, durch entsprechende Entlastungszeugnisse von ehemaligen Freunden und Kollegen zu belegen. Die generelle Problematik der "Persilscheine" ist bekannt und Kritik mehr als berechtigt. Dennoch sollte man mit Blick auf die skizzierten Ereignisse in Köln den Versuch unternehmen, die Stellungnahmen nicht pauschal zu diskreditieren, um ein differenziertes Bild der Lebensumstände zu bekommen.
Des Weiteren bezieht Klussmann ausdrücklich seine eigene Musik in die Argumentation seiner Entlastung mit ein. Als Beleg, dass seine Musiksprache in keinster Weise den ästhetischen Vorstellungen der Nationalsozialisten entsprach, beruft er sich auf entsprechend negative Rezensionen seiner Musik, wie z. B. von W. Trienes. Zudem betont Klussmann ausdrücklich seinen Bezug auf Gustav Mahler, in dessen Traditionslinie er seine Musik einordnet. Dass es sich dabei um kein Lippenbekenntnis handelt, lässt sich an einem Konvolut von Zeitungsartikeln, Typoskripten von verschiedenen Autoren über Mahler und Rezensionen zu Mahleraufführungen aus den 1920er bis 1930er Jahren festmachen, das sich im Nachlass von Klussmann befindet. Zudem gibt es diverse Texte von Klussmann, in denen er sich mit der Musik Mahlers beschäftigt und seine lebenslange Begeisterung zum Ausdruck bringt, wie z. B. eine Analyse der 9. Symphonie. Unter diesem Gesichtspunkt sind die Zeugenaussagen, die Klussmanns Beschäftigung mit Mahler in seiner Kölner Zeit betonen, die unter anderem zu Drangsalierungen durch seine Kollegen führte, ein nachvollziehbarer Aspekt der dortigen Umstände. Zu ergänzen ist in diesem Zusammenhang die Einschätzung vieler Zeitzeugen, dass Klussmann ein unpolitischer Mensch gewesen sei. Umso außergewöhnlicher ist seine Bemerkung über den Komponisten Hans Pfitzner: "Auch verzeihe ich ihm nicht, dass er frühere Werke Juden widmete, dann aber wie es 'aktuell' wurde, die Juden befehdete. Seine sämt. Schriften sind so widerwärtig polemisch und selbstbeweihräuchernd, dass ich diesen Teil seiner Produktion völlig ablehne." (Brief an Holger, 10.11.1944) Die Zentralstelle für Berufungsausschüsse teilte Klussmann im Oktober 1946 mit, dass seiner Berufung stattgegeben wurde. Allerdings enthielt die Entscheidung mit der Untersagung einer Tätigkeit als Leiter oder Lehrer einer Theater- oder Musikhochschule eine entscheidende Einschränkung, die Klussmann nicht akzeptieren konnte. In seinem Einspruch gegen das Urteil betonte er deshalb mit Nachdruck den Anspruch, wieder als Direktor eingesetzt zu werden. Im zweiten Verfahren, das sich bis 1948 hinzog, wurde Klussmann in die Kategorie V (Mitläufer) eingestuft. In einem Brief im März 1948 an Holger fasste er seine Empfindungen zusammen: "Ich zitiere mit den 'Meistersingern': Ihr mahnt mich da gar zu recht u. ich weiß für meine Säumnis u. mein Vergessen keine andere Entschuldigung als dass ich durch Gewalt u. Tempo einiger Ereignisse völlig überfahren wurde. Am 13.1 erreichte ich in 5-Stündiger Berufungsverhandlung Einstufung V und wurde am 16.2 wieder in mein altes Amt als Chef der Musikschule eingesetzt."
Im Jahr 1950 wurde Klussmann zum stellvertretenden Direktor der neu gegründeten Musikhochschule Hamburg ernannt, an der er bis zu seiner Pensionierung 1966 als Professor tätig war. Seine kompositorische Arbeit setzte Klussmann mit seiner V. Symphonie (1. Fassung 1950) fort, die eine eigentümliche Nähe zu seinem Vorbild Mahler aufweist. Es stellt sich die Frage, ob es sich dabei um einen Reflex handelt, sich seiner Tradition erneut zu vergewissern oder ob es als Anzeichen von Unsicherheit über die weitere Entwicklung seiner Musiksprache zu werten ist. Ab Mitte der 1950er Jahre beginnt Klussmann, die Dodekaphonie als Grundlage in seinen Kompositionen zu nutzen. Diese Neuaufstellung ist dabei wohl weniger auf den Einfluss der sich entwickelnden Nachkriegsavantgarde zurückzuführen, als vielmehr dem Umstand geschuldet, dass die Reihentechnik in hohem Maße mit Klussmanns kontrapunktischem Denken korrespondiert. Die Übernahme der Reihentechnik ist weniger eine ästhetische als vielmehr eine kompositionstechnische Entscheidung. Mit der Anfang der 1960er Jahre entstandenen 12-tönigen Oper Rhodope op. 50 und der daraus abgeleiteten VI. Symphonie op. 39 verband Klussmann die Hoffnung, als Komponist wieder Ansehen zu erlangen. Für die Ausstrahlung der Symphonie durch den Norddeutschen- Rundfunk 1964 ließ Klussmann eigens Karten mit dem Sendetermin drucken, die er an eine Vielzahl von Orchesterleitern, Opernintendanten und Regisseuren verschickte. Die überlieferten Antworten waren zwar höflich und wohlwollend, führten aber zu keiner Aufführung der Oper. Während einige kleinere Kompositionen in den folgenden Jahren aufgeführt wurden, hat er seine folgenden großen Werke, zwei große Opern und vier Symphonien, unbeirrt für die Schublade komponiert. Klussmann verstarb am 21. Januar 1975 in Hamburg.
Überblickt man die Biographie von Klussmann, aufgewachsen im Kaiserreich, studiert in der Weimarer Republik, Lehrer und Komponist in der NS-Zeit sowie in der Bundesrepublik, zeigt sich, dass er auf enorme politische Veränderungen während seines Lebens reagieren musste. Ein erster, sehr fragmentarischer Eindruck seiner Persönlichkeit lässt vermuten, dass Klussmann ein furchtsamer Mensch war, der darauf bedacht war, die Regeln und Gesetzte einzuhalten. Damit einher geht seine versucht unpolitische Haltung, die Entscheidungen des Staates zu akzeptieren. Seine Fixierung auf Musik korrespondiert interessanterweise mit seiner wachsenden Begeisterung für die Antike, die Holger in ihren Erinnerungen an Klussmann mit den Worten beschreibt: "Seine Lebensideale wurzelten im Humanismus der griechisch-römischen Antike, waren gewachsen in einem humanistischen Bildungsideal." Ob man darin eine Flucht vor der Realität sehen kann, sei dahingestellt. Festzuhalten bleibt, dass es von Klussmann weder ein Bekenntnis zu einer "deutschen Musik" gibt, die als Nähe zur NS-Ideologie bewertet werden kann, noch er sich aktiv für die Ziele des Nationalsozialismus eingesetzt hat.
Frühe Werke
Die Arbeit am Klavierquintett op. 1 in e-Moll beendete Klussmann, laut Eintrag am Ende der Partitur, am 07.06.1925 in München, wo am 24. Juni vermutlich auch die Uraufführung stattfand. Die Komposition kann offenkundig als Abschluss seiner Studienzeit angesehen werden. Die Wahl der Gattung Klavierquintett, die eine weniger ausgeprägte Gattungsnorm aufweist, kommt Klussmanns Vorliebe für die symphonische Musik entgegen, wie die frühen Kompositionsversuche belegen. Die Kombination von intensivem Streicherklang und vollem Klavierklang kann diesem Klangideal in besonderer Art und Weise entsprechen. Die Musiksprache des viersätzig konzipierten Werks weist einen spätromantischen Charakter auf. Aus den melodischen Linien der Streicher entwickeln sich dynamische Verdichtungen, die über eine kammermusikalische Gestaltung hinausgehen. Nach dem aufgeladenen "Espressivo" des 2. Satzes, der überwiegend vom kompakten Streicherklang getragen wird, schließt sich als 3. Satz ein kurzes, fast übermütig wirkendes Scherzo an. Im Finale wird schließlich die Musik innerhalb kurzer Zeit so dramatisch aufgeladen, dass der tonale Tonsatz aufgehoben zu sein scheint. Unterbrochen wird der Prozess durch eine Fuge, die Klussmanns Neigung zur Kontrapunktik charakteristisch herausstellt. Sein Lehrer Sigmund von Hausegger urteilte über die Uraufführung: "In einem öffentlichen Vortragsabend errang auch mit Recht ein eindrucksstarkes Klavierquintett von ihm den größten Beifall. Die selbständige, geistvolle Art, in der hier seine recht musikantischen, eigenwüchsigen Einfälle ineinanderfügt und zu einem wohlgerundeten Ganzen fortentwickelt, ist in der Tat überaus sympathisch und erweckt schöne Hoffnungen für das Weiterschaffen des Komponisten."
Das 1. Streichquartett op. 7, seinem Lehrer Joseph Haas gewidmet, komponierte Klussmann zwischen 1928 und 1930 in Köln, nachdem er seine 1. Symphonie beendet hatte. Die Uraufführung durch das Havemann-Quartett fand am 8. Juni 1933 im Rahmen des 60. Tonkünstlerfestes in Königsberg statt. Mit diesem Quartett hat Klussmann den Gestus der Spätromantik hinter sich gelassen. Die fünf Sätze sind, trotz unterschiedlicher Charaktere, durch ein Beziehungsgeflecht des motivischen Materials miteinander verknüpft. Die musikalische Entwicklung der einzelnen Sätze wird überwiegend durch kontrapunktische Stimmverläufe erzeugt. In einem Typoskript zum sinfonischen Schaffen Gustav Mahlers stellt er dessen Polyphonie vor, die sich wie eine Beschreibung seiner eigenen Kompositionsweise liest: "Mahlers Polyphonie ist von Anfang an keine 'schulmäßige'; sie entsteht aus dem Bedürfnis nach neuem Ausdruck: dementsprechend arbeitet sie nicht nach 'überkommenen' Regeln, sondern stellt sich ausschließlich unter das Gesetz des angestrebten Ausdrucks. Sie arbeitet in ihren Mittel z. B. mit unvorbereiteten Dissonanzen, mit parallelverlaufenden Sekunden, Quarten und Quinten, wirkt unkonventionell, hart und ist in ihrer Gesamterscheinung als Folge und Entwicklung der polyphonen Haltung des späten Beethovens anzusehen (Vorbild: Beethovens op. 133, Fuge B-Dur)." Welche Konsequenzen sich daraus für den Tonsatz ergeben, lässt sich am 5. Satz ablesen, wo durch die stringente Führung der Stimmen, der Tonsatz atonale Züge annimmt, die der Dodekaphonie Schönbergs nahekommt. Bezieht man die Differenzierung der Klangfarben mit ein, lässt sich die Musiksprache des Streichquartetts als modern bezeichnen. Dabei zeigt Klussmann subtile Ironie, wenn er den mit "Marsch" überschriebenen 3. Satz in einem gleichsam hinkenden 7/4-Takt komponiert.
Dr. Carsten Bock
März 2025
